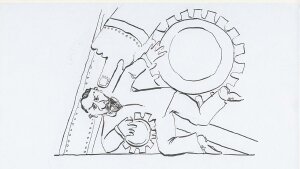-
#Arbeit und Ökonomie im Wandel
In diesem Schwerpunkt geht es um die Erforschung der Transformation von (Lohn-)Arbeitsgesellschaften und Arbeitsmärkten unter den Bedingungen einer intensivierten Globalisierung. Dabei geht es sowohl um Strukturveränderungen auf der Makroebene (Finanz-, Waren- und Arbeitsmärkte) als auch auf der Mikroebene (z.B. im Betrieb oder in der Familie) sowie um Aktivitäten und Aktionen individueller und kollektiver Akteure (z.B. Gewerkschaften). Prozesse der Prekarisierung sind in den Forschungsarbeiten des Institutes ebenso zentral, wie Entwicklungen der Finanzialisierung, der De-Standardisierung von Erwerbsarbeit, der Polarisierung von Arbeitsmärkten oder des Fachkräftemangels.
Geförderte Forschungsprojekte
BeaT – „Berufliche Bildung erneuern für die automobile Transformation: Qualifikatorische Bedarfsanalysen und Anpassungskonzepte zur Produktion, Zulieferung und Instandhaltung batteriegetriebener E-Mobilität; Teilvorhaben: Arbeit, Kompetenzen, Qualifizierung“Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Mitarbeiter*innen: Johanna Sittel, Lennart Michaelis
Laufzeit: 01.10.2021 - 30.09.2024Förderung: BMWK
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.beat-learning.info/Externer Link
Solidarität organisieren in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz (SONAR)
Gefördert vom BMBF, Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen: Judith Weger, Raoul Nozon, Peter Bescherer, Josephine Garitz (wissenschaftliche Assistenz)
Projektkoordination und wissenschaftliche Mitarbeiter: PD Dr. Peter Bescherer
Projektleitung: PD Dr. Peter Bescherer
weitere Informtionen: https://sonar-projekt.de/Externer Link
"Gesellschaft selber machen? Informelle Ökonomien und soziale Teilhabe in ländlichen Armutsräumen"
Projektleitung: Dr. Tine Haubner
Mitarbeiter*innen: Laura Boemke, Dr. Mike Laufenberg
Laufzeit: 2020-2023
Förderung: BMBF, Forschungsprojekt in der Förderlinie „Teilhabe und Gemeinwohl“
Weitere Infos zum Projekt: https://www.soziologie.uni-jena.de/arbeitsbereiche/politische-soziologie/forschungExterner Link
-
#Demokratie, Populismus und Strukturwandel des Öffentlichen
Die forcierte Digitalisierung und die wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke restrukturieren demokratische Öffentlichkeiten mit ambivalenten Effekten: Zum einen werden neue Formen demokratischer Auseinandersetzungen und massenhafter Mobilisierung ermöglicht, zum anderen unterminieren intransparente Algorithmen, der Schutz der Anonymität und die digitale Verbreitung von 'Fake News' den demokratischen Diskurs und stärken den Einfluss regressiver Kräfte. In diesem Schwerpunkt geht es um den Wandel und die Gefährdung der Demokratie unter Bedingungen des weltweit erstarkenden Rechtspopulismus einerseits sowie eines einseitig an Unternehmensinteressen orientierten Neoliberalismus andererseits. Die Frage nach den Ursachen für das Erstarken rechter Kräfte wird ebenso erforscht wie die anti-demokratischen Effekte einer auf Alternativlosigkeit und Sachzwanglogik angelegten Wirtschafts- und Austeritätpolitik. Die Diagnose eines grundsätzlichen, gleichwohl historisch unterschiedlich ausgestalteten Spannungsverhältnisses von Demokratie und Kapitalismus bildet den gemeinsamen Ausgangspunkt der Forschung in diesem Bereich.
Geförderte Forschungsprojekte
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C04
Auseinandersetzungen um das Öffentliche und die Zukunft der Commons. Eigentumsverhältnisse im Kontext wohlfahrtsstaatlicher TransformationExterner Link
Projektleitung: Prof. Dr. Silke van DykMitarbeiter*innen: Dr. Markus Kip, Luzie Gerstenhöfer
Förderung: DFG
Solidarität organisieren in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz (SONAR)
Gefördert vom BMBF, Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen: Judith Weger, Raoul Nozon, Peter Bescherer, Josephine Garitz (wissenschaftliche Assistenz)
Projektkoordination und wissenschaftliche Mitarbeiter: PD Dr. Peter Bescherer
Projektleitung: PD Dr. Peter Bescherer
weitere Informtionen: https://sonar-projekt.de/Externer Link
Weitere Forschungsvorhaben
Sebastian Sevignani, Arbeitsbereich Allgemeine und Theoretische Soziologie: Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit
Politische Öffentlichkeit ist wichtig für die Demokratie und sie wandelt sich – so ließe sich die Quintessenz von Jürgen Habermas´ monumentaler Studie zum Strukturwandel der Öffentlichkeit in einfachen Worten zusammenfassen. Heute sind es vor allem die Prozesse fortschreitender Kommodifizierung, Globalisierung und Digitialisierung, die eine Wiederaufnahme integrativer und gesellschaftskritischer Forschung zur Veränderungen der Öffentlichkeit notwendig machen. Insbesondere Öffentlichkeiten, die durch digtiale Medien organisiert werde, haben Prozesse der Disintermediation gesellschaftlicher Kommunikationsflüsse und anschließender Re-Intermediation durch vorwiegend kommerzielle Plattformen in Gang gesetzt. Dies hat große Auswirkungen auf die Organisation gesellschaftlicher Erfahrung, populistische Bewegungen, diskursives Lernen und demokratische Deliberationsmöglichkeiten.
Bisher sind im Rahmen dieses Projektes national und international sichtbare Publikationen hervorgegangen, z.B. ein Sonderband der Zeitschrift Leviathan (Seeliger und Sevignani 2021)Externer Link und eine Special Section von Theory, Culture & Society (Seeliger und Sevignani 2022) mit Beiträgen u.a. von Jürgen Habermas, Judith Butler, Nancy Fraser, Donatella della Porta, Hartmut Rosa und Michael Zürn. Ein Forschungsnetzwerk zum Thema ist im Entstehen und ein Forschungsprojekt zum Wandel proletarischer Öffentlichkeiten ist in Vorbereitung.Perspektiven der Mitbestimmung in Ganzheitlichen Produktionssystemen
Die Bemühungen um eine humanisierte und verstärkt selbstverantwortliche Arbeit, die in den 1980er und 1990er Jahren verbreitet waren, sind heute zu großen Teilen in Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) eingemündet. Diese Systeme nutzen die neuen Möglichkeiten informationstechnischer Steuerung und gelten - ausstrahlend von der Automobilindustrie - zunehmend als avancierteste Form, betriebliche Prozesse zu erfassen und zu optimieren. Die Hoffnungen, gestalterische Kompetenzen und Selbstverantwortung der Beschäftigten auszuweiten, sind dabei jedoch nur begrenzt zum Zug gekommen. GPS scheinen vielerorts v.a. Leistungsdruck zu erhöhen, nicht jedoch Mitwirkungschancen, und statt das implizite Wissen der Beschäftigten aufzuwerten, sind sie eher auf seine Extraktion und Zentralisierung angelegt. Die Forschungsgruppe untersucht auf wissenssoziologischer Grundlage und in praktischer Perspektive, inwieweit es möglich ist, den Ansatz produktiver Mitbestimmung in GPS neu zur Geltung zu bringen.
Im Einzelnen sind ihre Ziele:
- a) die aktuelle Bedeutung von GPS für die Gestaltungsmöglichkeiten der Beschäftigten zu identifizieren,
b) den veränderten Status von Beschäftigtenwissen und -kompetenzen im Rahmen von GPS zu erfassen, und
c) Perspektiven sowie anwendbare Instrumente weitergehender Demokratisierung zu entwickeln.
Die Grundidee ist dabei, dass erweiterte betriebliche Selbstreflexion immer zwei Seiten hat. Techniken, mit denen Arbeit und Kommunikation tiefenscharf kontrolliert werden, könnten auch Beschäftigte in die Lage versetzen, fortlaufend ihr Aufgabenfeld zu gestalten, über dessen Rahmen mit zu entscheiden und Arbeitsanforderungen mit ihrer Lebensführung zu koordinieren. Das Vorhaben ist methodisch explorativ angelegt und soll neue Impulse ins untersuchte Feld tragen. Dazu werden empirische Forschung (schwerpunktmäßig in a), theoriegeleitete Analyse (besonders in b) und die Sondierung neuer praktischer Chancen (besonders in c) verbunden.
- a) die aktuelle Bedeutung von GPS für die Gestaltungsmöglichkeiten der Beschäftigten zu identifizieren,
-
#Geschlechterverhältnisse, Care und Soziale Reproduktion
Weder Arbeitsgesellschaften noch Ungleichheits- oder Eigentumsverhältnisse können 'geschlechtsneutral' adressiert werden, weshalb ein geschlechtersensibler Blick eine Selbstverständlichkeit in allen Forschungsschwerpunkten ist. Zugleich bildet die Analyse von Geschlechterverhältnissen aber auch einen eigenen Schwerpunkt unserer Arbeit: Die Analyse von Männlichkeit (im Wandel) ist hier ebenso zentral wie die Untersuchung von Familienstrukturen, Paarbeziehungen und Sexualität im Wandel. Ausgehend von einem erweiterten Arbeitsbegriff, der neben Erwerbsarbeit auch unbezahlte Haus- und Sorgearbeit umfasst, wird im Institut ferner zur Krise der sozialen Reproduktion und zum Wandel von Care- und Sorgeverhältnissen in Zeiten familialen, wohlfahrtsstaatlichen und demographischen Wandels geforscht. In diesem Zusammenhang ist auch die Beschäftigung mit dem Alter(n) von Gesellschaft und Individuen ein zentraler Forschungsfokus.
Geförderte Forschungsprojekte
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt B06
Eigentumsungleichheit im Privaten. Zur institutionellen und kulturellen (Re-) Strukturierung von Eigentumsarrangements in PaarhaushaltenExterner LinkProjektleitung: Prof. Dr. Kathrin Leuze, Prof. Sylka Scholz
Mitarbeiter*innen: Dr. Agnieszka Althaber, Dr. Robin K. Saalfeld
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C02
Eigentum am menschlichen Körper im Kontext transnationaler Reproduktionsökonomien (C02)Externer Link
Projektleitung: PD Dr. Stefanie Graefe, PD Dr. Susanne LettowProjektmitarbeiter*innen: Irina Herb, Sophie Jossi-Silverstein
Förderung: DFG
„Fürsorgliche Jungen? Alternative (Forschungs-)Perspektiven auf die Reproduktionskrise“Projektleitung: Prof. Dr. Sylka Scholz
Mitarbeiter*innen: Nadine Nebiye Baser, Kevin Leja, Iris Schwarzenbacher
Laufzeit: 01.02.2019-31.04.2022
Förderung: DFG
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.soziologie.uni-jena.de/arbeitsbereiche/qualitative-methoden-und-mikrosoziologie/forschungExterner Link
Solidarität organisieren in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz (SONAR)
Gefördert vom BMBF, Laufzeit: Januar 2023 bis Dezember 2025
Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen: Judith Weger, Raoul Nozon, Peter Bescherer, Josephine Garitz (wissenschaftliche Assistenz)
Projektkoordination und wissenschaftliche Mitarbeiter: PD Dr. Peter Bescherer
Projektleitung: PD Dr. Peter Bescherer
weitere Informtionen: https://sonar-projekt.de/Externer Link
Weitere Forschungsvorhaben
Prof. Dr. Kathrin Leuze, Arbeitsbereich Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse: Individuelle und institutionelle Bedingungen auf geschlechts(un-)typische Berufsaspirationen im Jugendalter
Aus der Literatur ist es hinlänglich bekannt, dass Frauen und Männer in anderen Berufen arbeiten und dass diese geschlechtstypische „Berufswahl“ mit ungleichen Arbeitsmarkterträgen einhergeht. Allerdings ist bislang immer noch wenig darüber bekannt, warum sich junge Frauen und Männer für unterschiedliche Berufe interessieren und warum sich die geschlechtstypischen Berufsaspirationen zwischen industrialisierten Ländern unterscheiden. Daher untersucht das Projekt in einem ersten Schritt mögliche Einflussfaktoren für die Entwicklung von geschlechts(un-)typischen Berufsaspirationen in Deutschland und fokussiert auf die Bedeutung von Kompetenzen und Noten, das Elternhaus sowie das schulische Umfeld. In einem zweiten Schritt werden diese Analysen auf 30 Länder der EU und der OECD ausgeweitet. Untersucht wird zum einen, inwiefern kulturelle und institutionelle Länderunterschiede die geschlechtsstereotypen Berufserwartungen beeinflussen, und zum anderen, ob sich dadurch auch Länderunterschiede in den Präferenzen für MINT Berufe (Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik) erklären lassen.
Weitere Information unter https://www.fsv.uni-jena.de/fakultaet/institute-lehrstuehle/institut-fuer-soziologie/arbeitsbereiche/methoden-der-empirischen-sozialforschung-und-sozialstrukturanalyse/forschung, #Geschlechterverhältnisse, Care und Soziale Reproduktion
Dr. Charlotte Büchner, Arbeitsbereich Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse: Entwicklungsaufgaben und geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten
Das Habilitationsprojekt setzt sich mit differentiellen schulischen Leistungen und Bildungserfolgen von Jungen und Mädchen auseinander. Bisherige Studien zeigen, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der schulischen Bildungsbeteiligung und im Zertifikatserwerb vor allem im höheren Sekundarschulbereich zu finden sind und diese deutlich zugunsten der Mädchen ausfallen. Jungen sind proportional häufiger an Hauptschulen vertreten und verlassen die Schule häufiger ohne einen Abschluss, während Mädchen an Gymnasien überrepräsentiert sind und häufiger die Allgemeine Hochschulreife erlangen als Jungen. Aufbauend auf dem Konzept psychosozialer Entwicklungsaufgaben wird angenommen, dass Mädchen und Jungen zentrale Lebensbereiche im Jugendalter unterschiedlich bewältigen und dies im Zusammenhang mit ihren unterschiedlichen Bildungserfolgen steht. Für die empirische Untersuchung interessiert dabei die Frage, welche Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen in der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben Bindung, Regeneration und Partizipation bestehen und inwiefern diese zu geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten zuungunsten von Jungen beitragen. Neben dem Geschlecht wird auch das Bildungsmilieu der Jungen und Mädchen einbezogen, um im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem theoretischen Konzept differenziertere Erkenntnisse zu gewinnen. Die empirische Untersuchung basiert auf einer Fragebogenerhebung aus dem Jahr 2014, durchgeführt und finanziert durch den Lehrstuhl Allgemeine Erziehungswissenschaft und empirische Bildungsforschung der Universität Erfurt. Befragt wurden insgesamt 1.192 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen neun und zehn an deutschen Regelschulen und Gymnasien im Raum Mittelthüringen.
Ralf Minor, Arbeitsbereich Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse: Economic Issues in Higher Educational Pathways – Empirical Evidence on Whether and Where to Study and with Which Success
Das der Hochschulforschung zuzuordnende Dissertationsprojekt widmet sich den ökonomischen Einflüssen auf die Teilhabe, Durchführung und den Erfolg von tertiären Bildungswegen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Untersuchung von Aspekten der Sozialen Gerechtigkeit und Segregation bei unterschiedlichen Ausgangssituationen von Studierenden oder den Wirkungen politischer Interventionen. Die drei – im Rahmen dieser Dissertation entstehenden – Arbeitspapiere haben unterschiedliche Fokussierungen. Während Paper 1 die politische Intervention der Erhebung und Abschaffung von Studiengebühren auf Basis von Paneldaten untersucht, eruiert Paper 2 dieses Instrument und dessen unterschiedliche Ausprägungen mittels eines systematischen Reviews auf europäischer Ebene. Das dritte Paper untersucht Determinanten erfolgreicher Studienabschlüsse an deutschen Fachhochschulen auf Basis administrativer Individualdaten.
Projektlaufzeit: August 2019 – Juli 2022
Kooperationspartner: Prof. Dr. Matthias-Wolfgang Stoetzer, Ernst-Abbe-Hochschule JenaDr. Mike Laufenberg, Arbeitsbereich Politische Soziologie: Queere Theorien revisited
Queere Theorien analysieren, wie Sexualitäts- und Geschlechterverhältnisse im Kontext der Geschichte und Gegenwart von globalem Kapitalismus, Nationalstaat, Migration, Rassismus und (Post-)Kolonialismus reguliert und geformt, aber auch zum Ausgangspunkt für emanzipatorische Bewegungen werden. In den letzten 15 Jahren ist die Queer Theory gesellschafstheoretischer, materialistischer und transnationaler geworden als sie es in den 1990er Jahren war. Hierbei kommt es, wie beim queer und transgender marxism, zu gewinnbringenden Theorieentwicklungen, die vermeintlich inkompatible Theorietraditionen zusammenführen. Mike Laufenberg arbeitet derzeit an der Umsetzung von zwei Publikationsprojekten, die die Genealogie und Gegenwart der Queer Theory behandeln und die helfen wollen, die noch lückenhafte deutschsprachige Rezeption dieser Entwicklungen zu schließen: Queere Theorien zur Einführung (Junius Verlag) sowie, gemeinsam mit Ben Trott, Queer Studies. Schlüsseltexte (Suhrkamp) sollen beide 2022 erscheinen.
Dr. Sarah Uhlmann, Arbeitsbereich Politische Soziologie: Reproduktionskämpfe in der Stadt
Ausgehend von dem Befund zunehmender und zugleich vielfältiger Proteste in und um die Stadt untersucht das abgeschlossene Dissertationsprojekt die Gründe und Gemeinsamkeiten städtischer Proteste und fragt darüber hinaus, um welche Form sozialer Kämpfe es sich bei diesen handelt. Um die urbanen sozialen Bewegungen über den europäischen Kontext hinaus zu charakterisieren, erklären und klassifizieren zu können, wurden die Stadtentwicklungen und städtischen Protestinitiativen in New York City, Buenos Aires und Hamburg in einer qualitativen Fallstudie verglichen. Dabei zeigt sich zum einen, dass die urbanen sozialen Bewegungen gewisse sozialräumliche Inhalte und Praktiken, die vor allem auf eine Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen zielen, teilen. Zum anderen wird deutlich, dass die urbanen Proteste eine Reaktion auf eine zunehmende Inwertsetzung des städtischen Raums und generelle Prozesse der Landnahme darstellen. Aufbauend auf diesen empirischen Befund wird in der Arbeit eine klassentheoretische Deutung der Proteste entwickelt, wobei die urbanen sozialen Bewegungen als erweiterte Klassenauseinandersetzungen, die sich in der Sphäre der sozialen Reproduktion äußern, gefasst werden. Mit dieser Klassifizierung sollen somit nicht nur die politökonomischen Ursachen der Proteste benannt, sondern auch die Formierung der urbanen sozialen Bewegungen als politischer Akteur eingefangen werden. Indem das Forschungsprojekt die Verschränkung von Handlungs- und Strukturebenen in Bezug auf urbane Proteste analysiert, will es einen Beitrag zur sozialen Bewegungsforschung leisten.
Dr. Tine Haubner, Arbeitsbereich Politische Soziologie: Geld oder Leben - Sorge und Sorgearbeit im Kapitalismus
Brigitte Aulenbacher, Cornelia Klinger und Tine Haubner arbeiten gerade an der Publikation eines Buches mit dem Titel "Geld oder Leben - Sorge und Sorgearbeit im Kapitalismus". Die Publikation, die Sorge und Sorgearbeit im späten Kapitalismus ins Visier nimmt, geht von der Ausgangsannahme aus, dass im späten Kapitalismus nicht nur Arbeit, sondern das ganze Leben Maximen von Effizienz und Profit unterworfen werden soll. Sorge und Sorgearbeit werden dabei global neu geordnet und sind technologisch, wirtschaftlich, zivilgesellschaftlich und ‚privat‘ umkämpft. In die neue Ordnung des Sorgens schreiben sich zudem alte Macht- und Herrschaftsverhältnisse nach Gender, Race, Class ein. Die drei Autorinnen betrachten das spätkapitalistische Sorgeregime aus philosophischen und soziologischen Perspektiven. Ihre Sozial- und Zeitdiagnosen verbinden sie mit der Suche nach Wegen aus den Krisen gesellschaftlicher Reproduktion.
Das Buch soll im Frühjahr 2020 im Beltz-Verlag erscheinen: https://www.beltz.de/fachmedien/soziologie/produkte/produkt_produktdetails/40316-geld_oder_leben_sorge_und_sorgearbeit_im_kapitalismus.htmlExterner Link.
Prof. Dr. Sylka Scholz, Arbeitsbereich Qualitative Methoden und Mikrosoziologie: Caring Masculinities. Zur Relation von Fürsorge und Männlichkeiten
Männer werden neuerdings (wieder) stärker in den Fürsorgebereich involviert. Sie tauchen in der Position des aktiven Vaters, des Fürsorgegebers in der häuslichen Pflege von Familienangehörigen, in der Alten-/Krankenpflege oder des Erziehers in der Kita auf. Sichtbar wird, dass Fürsorglichkeit/Care gegenwärtig neu verhandelt wird. Die Fürsorglichkeit/Care ist in modernen kapitalistischen Gesellschaften dem weiblichen Geschlechtscharakter zugeschrieben. Diese Relation bricht aus unterschiedlichen Gründen auf. Seit mehreren Jahren beschäftige ich mich mit dem Zusammenhang von Männern, Männlichkeiten und Fürsorge. Mich interessiert, ob und wie die Erfahrungen als Care-Giver die individuellen Männlichkeitskonstruktionen verändern. Und weitergehend: Können Fürsorgeerfahrungen das Potential einer subjektiven Transformation entfalten? Beziehen sich diese nur auf den privaten Lebensbereich? Entwickelt sich eine Fürsorgehaltung, die sich auch politisieren ließe etwa hinsichtlich des Engagements für eine demokratische Postwachstumsgesellschaft? Vor diesem Hintergrund habe ich gemeinsam mit Andreas Heilmann ein Hearing zum Thema „Männlichkeiten in kapitalistischen Wachstumgesellschaften“ (Januar 2018) im Kolleg Postwachstumsgesellschaften organisiert und mehrere Aufsätze publiziert u.a. „Caring Masculinities – gesellschaftliche Transformationspotentiale fürsorglicher Männlichkeiten?“ in: Feministische Studien, Schwerpunkt Postwachstum, 31. Jg. H. 2, 349-357 und Repliken, ebd., 369-373). 2019 ist der Tagungsband „Caring Masculinities. Männlichkeiten in der Transformation kapitalistischer Wachstumsgesellschaften“ beim Oekom Verlag München erschienen. Das Thema verfolge ich in dem Forschungsprojekt „Fürsorgliche Jungen? Alternative (Forschungs-)Perspektiven auf die soziale Krise der Reproduktion“ weiter. Im Schwerpunktheft „Sorgende Männer. Perspektiven der Geschlechterforschung auf Männlichkeit und Care“ der Zeitschrift Gender erscheint im Frühjahr der Aufsatz “Fürsorge sichtbar werden lassen – Eine tiefenhermeneutische Analyse der Lebenswelten männlicher Jugendlicher“ (mit Aaron Korn). Das Forschungsprojekt „Studien- und Berufswahl von männlichen Jugendlichen im Feld von Sorge-Tätigkeiten“ diskutiert, inwieweit sich Caring Masculinities im Bereich der Alten- und Krankenpflege entwickeln. Die Ergebnisse erscheinen in dem Sammelband „Jungen, männliche Jugendliche und junge Männer in Bildungskontexten“ herausgegeben von Jürgen Budde und Thomas Viola Rieske beim Verlag Barbara Budrich im Frühjahr 2022.
-
#Sozial-ökologische Transformation und (Post-)Wachstumsgesellschaften
Wir erleben derzeit eine Kumulation ökologischer Gefahren, die planetarische Belastungsgrenzen überschreiten oder zu überschreiten drohen. Diese Herausforderungen sind nicht von grundlegenden Fragen des Wachstums und der kapitalistischen Akkumulationsdynamik zu trennen und sie sind eng mit sozialen Fragen und Ungleichheiten verwoben. In diesem Schwerpunkt wird deshalb der Zusammenhang von ökologischen und sozialen Problemen erforscht und das Wirtschaftswachstum in seinen sozizio-kulturellen, ökologischen und politischen Implikationen in den Blick genommen. Die Analyse des Abflachens ökonomischer Wachstumsraten in den früh industrialisierten Ländern bei hoher Dynamik aufholender Hochwachstumsgesellschaften (v.a. China und Indien) spielt in diesem Forschungsschwerpunkt eine ebenso zentrale Rolle wie die Untersuchung konkreter, nachhaltiger alternativer Ökonomien oder mit der Energiewende verbundener Herausforderungen, untersucht werden u.a. Inhalte und Ausprägungen sozialökologischer Transformationskonflikte im Mobilitäts- und Energiesektor, wo sich radikale Strukturumbrüche abzeichnen. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig werden insbesondere gesellschaftliche Widersprüche in Prozessen der Nachhaltigkeitstransformation untersucht.
Geförderte Forschungsprojekte
"Integratives Water-Assessment: Kennzahlgestützte Bewertung des nachhaltigen Umgangs mit Wasser (WatAs)"Projektleitung: Dr. Diana Lindner
Mitarbeiter*in: Dr. Diana Lindner
Laufzeit: 15.04.2023-14.04.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/watas
"Sozial differenzierter Wasserverbrauch der Haushalte - Aktualität und Perspektiven nachhaltiger Wassernutzung (HaVe)"
Projektleitung: apl. Prof. Dr. Stephan Lorenz
Mitarbeiter*in: Dr. Stefan Brachat
Laufzeit: 01.04.2023-31.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/have
"Verfahrensmodelle: Netzwerke sozialökologischer Transformation und sozio-technische Transdisziplinarität (VerNetzt)"Projektleitung: apl. Prof. Dr. Stephan Lorenz
Mitarbeiter*innen: Grete Luise Butzer, Laura Künzel
Laufzeit: 01.04.2023-31.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster THWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/vernetzt
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C03
Windernte und Wärmeklau als Indikatoren neuer EigentumsordnungenExterner Link
Projektleitung: Prof. Dr. Matthias Groß
Mitarbeiter*innen: Dr. Marco Sonnberger, Maria Pfeiffer
Förderung: DFGBeaT – „Berufliche Bildung erneuern für die automobile Transformation: Qualifikatorische Bedarfsanalysen und Anpassungskonzepte zur Produktion, Zulieferung und Instandhaltung batteriegetriebener E-Mobilität; Teilvorhaben: Arbeit, Kompetenzen, Qualifizierung“
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Mitarbeiter*innen: Johanna Sittel, Lennart Michaelis
Laufzeit: 01.10.2021 - 30.09.2024Förderung: BMWK
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.beat-learning.info/Externer Link
Nachwuchsgruppe: Mentalitäten im FlussProjektleitung: Dr. Martin Fritz
Laufzeit: 2019-2024
Förderung: BMBF
Weitere Informationen zur Nachwuchsgruppe hierExterner Link und unter www.flumen.uni-jena.deExterner Link
h2-well - Sozialwissenschaftliche Begleitforschung zur Konzeption des Markthochlaufs von Wasserstofftechnologien
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Mitarbeiter*innen: Anna Mehlis, Stephan Humbert, Anne Jasmin Bobka
Laufzeit: 01.12.2020 - 30.11.2023Förderung: BMBF
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.h2well.de/startseite.htmlExterner Link
h2-well Markthub - Wissenschaftlich-strategische Begleitung und Förderung der Marktdiffusion von Wasserstofftechnologien in der Innovationsregion; Teilvorhaben: Sozialwissenschaftliche Analyse dezentraler Wasserstofferzeugung und -nutzung
Projektleitung: Prof. Klaus Dörre
Wissenschaftliche Mitarbeiter*in: Fabian Pflügler
Förderung: BMBF
Laufzeit: 01.03.2023 - 31.12.2025
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.h2well.de/startseite.htmlExterner Link
-
#Technologischer Wandel, Digitalisierung und Informationsgesellschaft
Rasanter technologischer Wandel strukturiert Arbeits- und Lebensverhältnisse im Allgemeinen sowie die Verarbeitung von Wissen und Informationen im Besonderen von Grund auf neu. In diesem Forschungsschwerpunkt werden die Bedingungen und Folgen forcierter Digitalisierung in der Arbeitswelt (Stichwort 'Industrie 4.0') und Freizeit ebenso untersucht wie Fragen des geistigen Eigentums in der digitalisierten Wissensökonomie, die Bedeutung von Wissen und Informationen für die Transformation des Gegenwartskapitalismus (Stichwort 'Postkapitalismus' oder 'Wissenskapitalismus') oder die Veränderung von Zeit- und Eigentumsstrukturen an den Finanzmärkten, wenn Wertpapiere, automatisiert gehandelt, nur noch für Bruchteile von Sekunden gehalten werden. Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungsarbeiten in diesem Bereich ist die Untersuchung der Re-Strukturierung von 'Privatheit' bzw. Privatsphäre und Öffentlichkeit(en) in Prozessen der Digitalisierung.
Geförderte Forschungsprojekte
"ZeTT Plus - Zentrum Digitale Transformation Thüringen"
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Geschäftsführung: Dr. Thomas EngelMitarbeiter*innen: Alexandra Bernhardt, Oskar Butting, Vitus Forster, Manfred Füchtenkötter, Nóra Fülöp, Christian Schädlich, Jorin vom Bruch, Kathrin Wiese, Jan Zipperling
Laufzeit: Januar 2023-Dezember 2026
Förderer: BMAS (Zukunftszentren-Programm), TMASGFF aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF Plus)
Weitere Informationen: https://zett-thueringen.deExterner Link
"Integratives Water-Assessment: Kennzahlgestützte Bewertung des nachhaltigen Umgangs mit Wasser (WatAs)"Projektleitung: Dr. Diana Lindner
Mitarbeiter*in: Dr. Diana Lindner
Laufzeit: 15.04.2023-14.04.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/watas
"Quantifiziertes Wasser: Konvergenzen und Konflikte bei der Entwicklung und Nutzung von Wasserdaten (QuaWaKon)"
Projektleitung: Dr. Peter SchulzMitarbeiter*innen: Sarah Christel, Dr. Peter Schulz
Laufzeit: 15.03.2023-14.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/quawakon
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C02
Eigentum am menschlichen Körper im Kontext transnationaler Reproduktionsökonomien (C02)Externer Link
Projektleitung: PD Dr. Stefanie Graefe, PD Dr. Susanne LettowProjektmitarbeiter*innen: Irina Herb, Sophie Jossi-Silverstein
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C03
Windernte und Wärmeklau als Indikatoren neuer EigentumsordnungenExterner Link
Projektleitung: Prof. Dr. Matthias Groß
Mitarbeiter*innen: Dr. Marco Sonnberger, Maria Pfeiffer
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C05
Geistiges Eigentum: Soziale Einbettung und funktionale ÄquivalenteExterner LinkProjektleitung: Prof. Dr. Tilman Reitz, Dr. Sebastian Sevignani
Mitarbeiter*innen: Marlen van den Ecker
Förderung: DFG"Work in Transformation: New challenges in the context of digitalization and decarbonization in Argentina and Germany (TransWorkDD)"
Projektleitung: Dr. Johanna Sittel
Laufzeit: 01.01.2023-31.12.2024
Förderung: DAAD (Programme des Projektbezogenen Personenaustauschs (PPP))
„Freiwilligkeit als Ressource im Gegenwartskapitalismus“
Projketleitung: Prof. Dr. Silke van Dyk und PD Dr. Stefanie Graefe
Mitarbeiter: Dr. Philipp Lorig
Laufzeit: November 2020-Dezember 2023
Förderung: Das Projekt ist Teil der DFG-Forschungsgruppe FOR 2983 "Freiwilligkeit", die schwerpunktmäßig an der Universität Erfurt verankert ist.
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.voluntariness.org/de/project/freiwilligkeit-und-kapitalismus/Externer Link
Weitere Forschungsvorhaben
Sebastian Sevignani, Arbeitsbereich Allgemeine und Theoretische Soziologie: Theorien und Probleme des Digitalen Kapitalismus
Derzeit ist ein neuerliches Interesse der kritischen Theorie am Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsform zu beobachten. Der Digitale Kapitalismus wird zunehmend zum Bezugspunkt für kritische Zeitdiagnosen gesellschaftlicher Entwicklung, wobei deutlich wird, dass kapitalismus-theoretisches und -kritisches Nachdenken entgegen älterer, verfrühter und optimistischer Einschätzungen eines durch Technologieentwicklung forcierten “Rückzug des Kapitalismus” (Rifkin) und eines Eintrittes in die “Wissens-” (Stehr) oder “Netzwerkgesellschaft” (Castells) nichts an ihrer Aktualität für eine gesellschaftliche Selbstverständigung und Praxis verloren haben. Dabei fällt zweierlei auf: Einerseits besteht keine Einigkeit darüber, was die Spezifika des Digitalen Kapitalismus sind. Handelt es sich um eine Dimension oder Phase kapitalistischer Entwicklung, gibt es eine Kontinuität oder einen Bruch zu grundlegenden Merkmalen kapitalistischer Gesellschaften, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich in den verwandten Diagnosen z.B. eines Wissens-, High-Tech-, Online-, kognitiven, informationellen Kapitalismus benennen? Andererseits erfolgt die Bezugnahme auf den Digitalen Kapitalismus meist im Rahmen von Teilbeobachtungen bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungen oder in einzelnen gesellschaftlichen Feldern (siehe oben), was aber fehlt ist eine gesellschaftstheoretische Synthese.
Das Projekt steht im Zusammenhang mit einem gemeinsam mit Simon Schaupp und Tanja Carstensen herausgegebenen Band zu Theorien des Digitalen Kapitalismus. Dieser Band ist als Standartwerk zum Thema unter Beteiligung der international einschlägigen Forscher*innen (z.B. Ursula Huws, Felix Stalder, Kylie Jarret, Eran Fisher, Brigitte Aulenbacher, Wolfgang F. Haug, Nick Srnicek, Jamie Woodcock, Trebor Scholz, Helen Hester, Jodi Dean, Judy Wiachman, Oliver Nachtwey) konzipiert und wird 2023 bei Suhrkamp (Zusage) erscheinen.
Teil des Projektes ist eine kumulierten Habilitationschrift mit dem Titel „Arbeit und Kommunikation im Digitalen Kapitalismus“, die sozialtheoretisch argumentiert, dass die in den Sozialwissenschaften verbreite Entgegensetzung von Arbeit und Kommunikation als ganz unterschiedliche Formen des Handelns den Blick auf wichtige Phänomenbereiche des Digitalen Kapitalismus, wie z.B. Prosumption, algorithmische Steuerung und neue Formen der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit verstellt. Im polit-ökonomischen Teil geht es um die Weiterentwicklung einer kritischen kukturellen politischen Ökonomie der Medien und der Kommunikation und um Fallanalysen zu wichtigen Aspekten des Digtialen Kapitalismus (Datenökonomie, Strukturwandel der Öffentlichkeit, digtiale Bedürfnisse). Auch das Teilprojekt C05 im Transregio SFB 294Externer Link ist in diesem Kontext zu verorten.
-
#Ungleichheit, Klassen- und Eigentumsverhältnisse
Eng verbunden mit der Transformation von Arbeitsgesellschaften ist die Entwicklung globaler und nationaler sozialer Ungleichheit(en). Wir erleben gegenwärtig die Zunahme von Einkommens- und Vermögensungleichheiten innerhalb der meisten nationalen Gesellschaften, bei gleichzeitiger Abnahme von Ungleichheiten zwischen den Staaten des Nordens und des Südens. In diesem Schwerpunkt geht es um die empirische Erforschung von Verteilungs- und Sozialstrukturen sowie Bildungsverläufen, um die Untersuchung von Klassenverhältnissen und -konflikten sowie um die Analyse wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und sozialpolitischer Instrumente in ihrem Einfluss auf gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse. Zentral ist im Institut zudem die Analyse von Eigentumsverhältnissen, welche in der Soziologie ob ihrer Konzentration auf die Verteilung von Einkommen und Gütern jahrzehntelang vernachlässigt worden sind.
Geförderte Forschungsprojekte
Das transformative Potential des Teilens
Projektleitung: Dr. Jörg Oberthür, Prof. Dr. Hartmut Rosa
Mitarbeit: Dr. Gianna Behrendt
Laufzeit: 01.01.2023-31.12.2026
Förderung: BMBF (Nucleus Jena)Weitere Informationen zum Projekt:
Seit Anfang 2023 ist das Drittmittelprojekt ‚Das transformative Potenzial des Teilens‘ mit einer Laufzeit von vier Jahren am Arbeitsbereich für allgemeine und theoretische Soziologie, federführend durch Jörg Oberthür, Hartmut Rosa und Bettina Hollstein vom Max-Weber-Kolleg Erfurt, angesiedelt. Das Teilprojekt gehört zum Verbundvorhaben der FSU und EAH Nucleus Jena – Transfer.Regional.NachhaltigExterner Link, in dessen zweiter Förderphase. Ziel von Nucleus ist es, mit forschungsbasiertem Ideen-, Wissens- und Technologietransfer Innovationsprozesse in Jena und im Raum Ostthüringen zu fördern. Das Teilvorhaben ‚Das transformative Potenzial des Teilens‘ knüpft an Inhalte des Sonderforschungsbereichs/Transregios 294 ‚Strukturwandel des Eigentums‘ an und ist dem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Ausgehend von der Annahme, dass Sharing-Konzepte einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigkeitorientierten Transformation leisten können, werden aktuelle Forschungsinhalte aus dem SFB-Teilprojekt ‚Dinge verfügbar machen. Eigentum als spezifische Form der Weltbeziehung‘Externer Link, das verschiedene Felder der Sharing Economy analysiert, in ein praxisorientiertes Lehr-Lernformat eingebracht: Im Sinne eines beidseitigen Wissenstransfers werden mit Praxispartner*innen aus dem Bereich ‚Sharing‘ bzw. partizipativer Konzepte studentische Mikroprojekte durchgeführt. Die Ergebnisse werden für sämtliche universitäre wie nicht universitäre Akteur*innen der Anwendungsfelder in einem für 2024 geplanten ‚Sharing Symposium Thüringen‘ eingebracht und zuletzt in einem Dialog- und Ergebnisworkshops sowie einem digitalen Best Practice-Leitfaden festgehalten.
Wasserverteilungskonflikte in Deutschland (WaVe)Projektleitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa
Mitarbeiter*in: Magdalena Riedl
Laufzeit: 01.04.2023-31.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/wave
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt B05
Eigentum, Ungleichheit und Klassenbildung in sozialökologischen TransformationskonfliktenExterner LinkProjektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Mitarbeiter*innen: Dr. Steffen Liebig, Kim SAntonia Lucht
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt B06
Eigentumsungleichheit im Privaten. Zur institutionellen und kulturellen (Re-) Strukturierung von Eigentumsarrangements in PaarhaushaltenExterner LinkProjektleitung: Prof. Dr. Kathrin Leuze, Prof. Sylka Scholz
Mitarbeiter*innen: Dr. Agnieszka Althaber, Dr. Robin K. Saalfeld
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C02
Eigentum am menschlichen Körper im Kontext transnationaler Reproduktionsökonomien (C02)Externer Link
Projektleitung: PD Dr. Stefanie Graefe, PD Dr. Susanne LettowProjektmitarbeiter*innen: Irina Herb, Sophie Jossi-Silverstein
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C04
Auseinandersetzungen um das Öffentliche und die Zukunft der Commons. Eigentumsverhältnisse im Kontext wohlfahrtsstaatlicher TransformationExterner Link
Projektleitung: Prof. Dr. Silke van DykMitarbeiter*innen: Dr. Markus Kip, Luzie Gerstenhöfer
Förderung: DFG
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Junior Research Team JFT03
Eigentum an genetischen Ressourcen. Zur Aneignung traditionellen Wissens in der BioökonomieExterner Link
Projektleitung: Prof. Dr. Maria Backhouse, PD Dr. Anne TittorMitarbeiter*innen: Dr. Eduardo Relly
Förderung: DFG
Gesellschaft selber machen? Informelle Ökonomien und soziale Teilhabe in ländlichen Armutsräumen
Projektleitung: Dr. Tine Haubner
Mitarbeiter*innen: Laura Boemke und Dr. Mike Laufenberg
Laufzeit: 2020-2023
Förderung: BMBF, Forschungsprojekt in der Förderlinie „Teilhabe und Gemeinwohl“
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.soziologie.uni-jena.de/arbeitsbereiche/politische-soziologie/forschungExterner Link
Weitere Forschungsvorhaben
Björn Leitzen, Arbeitsbereich Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse, Dissertationsprojekt: Bedingungen und Konsequenzen herkunftsspezifischer Studienfachwahl
Das Dissertationsprojekt widmet sich der Frage, warum Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft unterschiedliche Studienfächer wählen und welche Konsequenzen sich daraus für den Studienverlauf und den Zugang zur Promotion ergeben. So wird erstens gezeigt, welche herkunftsspezifischen Ungleichheiten bei der Studienfachwahl bestehen und wodurch sich diese erklären lassen. Zweitens wird die Frage bearbeitet, welche Konsequenzen die herkunftsspezifische Studienfachwahl für den weiteren Studienerfolg von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft hat. Drittens wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen die herkunftsspezifische Studienfachwahl für herkunftsspezifischen Ungleichheiten beim Zugang zur Promotion besitzt. Durch die Betrachtung von Ursachen und Konsequenzen des Phänomens an unterschiedlichen Zeitpunkten – vor Studienbeginn, im Studienverlauf und nach Studienabschluss - entsteht ein umfassendes Bild der empirisch vielfach bestätigten aber bisher noch nicht hinreichend erforschten herkunftsspezifischen Disparitäten bei der Studienfachwahl. Dabei liegt der Fokus stets auf der weitreichenden Bedeutung herkunftsspezifischer Studienfachwahl für die Reproduktion von sozialer Ungleichheit.
Projektlaufzeit: Oktober 2018 - März 2025
Kooperationspartner: Dr. Markus Lörz, Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)
Das Dissertationsprojekt wird zum Teil im Rahmen des Brückenprojekts Studienfachwahl: Determinanten, Prozesse und soziale Reproduktion am Leibniz Center for Science and Society (LCSS)Externer Link bearbeitet.
-
#Zeit-, Subjekt- und Weltverhältnisse im Wandel
In diesem Forschungsschwerpunkt stehen die Subjekte und ihre Vergesellschaftung unter spätmodernen Bedingungen im Zentrum. Hier werden Fragen der Subjektivierung unter Bedingungen einer aktivierenden Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik ebenso untersucht wie die gesellschaftlichen und individuellen Konsequenzen einer zunehmend beschleunigten Arbeits- und Lebenswelt oder das Phänomen sozialer Erschöpfung (Stichwort 'Burnout'). Auch die grundlegende Frage, wer überhaupt als soziales Subjekt akzeptiert wird, ist Gegenstand dieses Schwerpunkts und strukturiert die Beschäftigung mit sozialen Kämpfen gegen die Ausgrenzung und Diskriminierung bestimmter Subjektpositionen (z.B. von so genannten 'Hartzern' oder von Transgender-Personen). Mit Blick auf Zeitverhältnisse wird untersucht, inwiefern sich das gesellschaftliche Zeitverständnis oder typische Muster der Zeitverwendung wandeln. Als Weltverhältnisse werden schließlich die Beziehungen der Subjekte zu ihrer Umwelt analysiert, verbunden mit der Frage, unter welchen Bedingungen Menschen ein resonantes Weltverhältnis realisieren.
Geförderte Forschungsprojekte
Das transformative Potential des Teilens
Projektleitung: Dr. Jörg Oberthür, Prof. Dr. Hartmut Rosa
Mitarbeit: Dr. Gianna Behrendt
Laufzeit: 01.01.2023-31.12.2026
Förderung: BMBF (Nucleus Jena)Weitere Informationen zum Projekt:
Seit Anfang 2023 ist das Drittmittelprojekt ‚Das transformative Potenzial des Teilens‘ mit einer Laufzeit von vier Jahren am Arbeitsbereich für allgemeine und theoretische Soziologie, federführend durch Jörg Oberthür, Hartmut Rosa und Bettina Hollstein vom Max-Weber-Kolleg Erfurt, angesiedelt. Das Teilprojekt gehört zum Verbundvorhaben der FSU und EAH Nucleus Jena – Transfer.Regional.NachhaltigExterner Link, in dessen zweiter Förderphase. Ziel von Nucleus ist es, mit forschungsbasiertem Ideen-, Wissens- und Technologietransfer Innovationsprozesse in Jena und im Raum Ostthüringen zu fördern. Das Teilvorhaben ‚Das transformative Potenzial des Teilens‘ knüpft an Inhalte des Sonderforschungsbereichs/Transregios 294 ‚Strukturwandel des Eigentums‘ an und ist dem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Ausgehend von der Annahme, dass Sharing-Konzepte einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigkeitorientierten Transformation leisten können, werden aktuelle Forschungsinhalte aus dem SFB-Teilprojekt ‚Dinge verfügbar machen. Eigentum als spezifische Form der Weltbeziehung‘Externer Link, das verschiedene Felder der Sharing Economy analysiert, in ein praxisorientiertes Lehr-Lernformat eingebracht: Im Sinne eines beidseitigen Wissenstransfers werden mit Praxispartner*innen aus dem Bereich ‚Sharing‘ bzw. partizipativer Konzepte studentische Mikroprojekte durchgeführt. Die Ergebnisse werden für sämtliche universitäre wie nicht universitäre Akteur*innen der Anwendungsfelder in einem für 2024 geplanten ‚Sharing Symposium Thüringen‘ eingebracht und zuletzt in einem Dialog- und Ergebnisworkshops sowie einem digitalen Best Practice-Leitfaden festgehalten.
Sozial differenzierter Wasserverbrauch der Haushalte - Aktualität und Perspektiven nachhaltiger Wassernutzung (HaVe)Projektleitung: apl. Prof. Dr. Stephan Lorenz
Mitarbeiter*in: Dr. Stefan Brachat
Laufzeit: 01.04.2023-31.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/have
Leben am Wasser: Gewässerverschmutzung im Globalen Süden (LeWa)Projektleitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa
Mitarbeiter*in: Dr. Alexis Gros
Laufzeit: 01.04.2023-31.03.2026
Förderung: BMBF (Thüringer Wasserinovationscluster ThWIC)
Weitere Informationen zum Projekt: https://www.thwic.uni-jena.de/projekte/lewa
Sonderforschungsbereich 294 "Strukturwandel des Eigentums"
Teilprojekt C06
Dinge verfügbar machen. Eigentum als spezifische Form der WeltbeziehungExterner LinkProjektleitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa, Dr. Jörg Oberthür
Mitarbeiter*innen: PD Dr. Christoph Henning, Henrike Katzer, Helen Bönnighausen
Förderung: DFG
Weitere ForschungsvorhabenPD Dr. Stefanie Graefe, Arbeitsbereich Politische Soziologie: Forschung zu Resilienz
Mit dem Thema arbeitsbedingte Erschöpfung und der gesellschaftlichen Debatte um die steigende Zahl stressbedingter Erkrankungen beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren. Besonders interessiert mich dabei die uneindeutige „Natur“ der Erschöpfung – sie ist ebenso ein gesellschaftlicher Diskurs, der mit Prozessen der so genannten „Therapeutisierung des Sozialen“ in Zusammenhang steht, wie eine Konsequenz der spezifischen und oftmals belastenden Anforderungen, die aus flexibilisierten Arbeits- und Lebensverhältnissen resultieren. Interessanterweise taucht seit einiger Zeit ein neuer Begriff auf, der nicht nur einen Ausweg aus Stress und Überlastung zu versprechen scheint, sondern sich zugleich als Lösungskonzept für gesellschaftliche Probleme aller Art anbietet: Resilienz. Gemeint ist damit eine flexible Widerstandsfähigkeit, die unterschiedlichste soziale und natürliche Akteure mit einer Art Immunschutz gegen die krisenförmige Gegenwart auszustatten scheint. Mich interessieren die konzeptionellen und normativen Implikationen des Resilienzkonzeptes: Ist das resiliente Subjekt ein Gegenentwurf zu jenem „erschöpften Selbst“ (Alain Ehrenberg), das für den flexiblen Kapitalismus so typisch zu sein scheint? Meine Überlegungen erscheinen in Form eines längeren Essays im Herbst im transcript-Verlag:
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4339-8/resilienz-im-krisenkapitalismus/Externer Link
-
# Arbeit und Ökonomie im Wandel
Arbeitsnehmerperspektiven auf die Konversionschancen der Automobilindustrie in Ostdeutschland (KonvAT)
Projektleitung: Prof. Klaus Dörre
Förderung: Stiftung zur Förderung arbeitsmarktpolitischer Vorhaben in den Neuen Ländern (OBS)
Laufzeit: 16.04.2018 - 31.07.2019
weitere Infos zum Projekt: https://www.soziologie.uni-jena.de/Arbeitsbereiche/Arbeits__+Industrie_+und+Wirtschaftssoziologie/Forschung.html
-
# Demokratie, Populismus und Strukturwandel des Öffentlichen
Verbundprojekt: Neue Konturen von Produktion und Arbeit. Verstetigung des interdisziplinären Zentrums für IT-basierte qualitative arbeitssoziologische Forschung (eLabour II).
"Betriebsrätehandeln und gewerkschaftliche Erneuerung" und Mitarbeit am Aufbau des Zentrums
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Förderung: BMBF
Laufzeit: 01.10.2018 - 30.09.2020
weitere Infos zum Projekt: www.elabour.deExterner Link
Populismus und Demoktratie in der Stadt (PODESTA)
Projektleitung: PD Dr. Peter Bescherer (Koordination), PD Dr. Robert Feustel
Laufzeit: 2017–2020
Förderung: BMBF
-
# Geschlechterverhältnisse, Care und Soziale Reproduktion
„Studien- und Berufswahl von männlichen Jugendlichen im Feld von Sorge-Tätigkeiten“
Projektleitung: Prof. Dr. Sylka Scholz
Förderung: Teilprojekt im BMFSFJ geförderten Verbundprojekt „Jungen und Bildung“
Projektlaufzeit: 01.11.2018-30.09.2021
Neue Kultur des Helfens oder Schattenökonomie - Engagement und Freiwilligenarbeit im Strukturwandel des Wohlfahrtsstaats
Projektleitung: Prof. Dr. Silke van Dyk und Dr. Tine Haubner
Förderung: Hans-Blöcker-Stiftung
Laufzeit: 2017-2020
-
# Sozial-ökologische Transformation und (Post-)Wachstumsgesellschaften
Nachwuchsgruppe: Globale Ungleichheiten und sozial-ökologischer Wandel
Projektleitung: Dr. Maria Backhouse
Förderung: BMBF
Laufzeit: 1.7.2016 bis zum 31.05.2022
weitere Infos zum Projekt: https://www.bioinequalities.uni-jena.de/
Sozial-ökologische Widersprüche kapitalistischer Landnahme: Das Beispiel der Holz- und Wasserwirtschaft in Südchile
Projektleitung: Prof. Klaus Dörre, Dr. Stefan SchmalzFörderung: DAAD
Laufzeit: 01.04.2015 - 31.12.2019
weitere Infos zum Projekt: http://www.patagonia.uni-jena.de/Externer Link
DFG-Kolleg-Forschergruppe Postwachstumsgesellschaften: "Landnahme, Beschleunigung, Aktivierung, Dynamik und (De-)Stabilisierung moderner Wachstumsgesellschaften"
Antragsteller:
Prof. Dr. Klaus Dörre, Prof. Dr. Stephan Lessenich, Prof. Dr. Hartmut Rosa
Geschäftsführung:
Dr. Karina Becker, Wissenschaftliche Leitung
Christine Schickert, Organisatorische Leitung und Öffentlichkeitsarbeit
Ilka Scheibe, Assistentin der GeschäftsführungFörderung: DFG
Laufzeit: Oktober 2011 - September 2019
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen:
Dr. Dennis Eversberg, Arbeitsschwerpunkte: Macht- und Subjektivitätsanalyse, Arbeits- und Arbeitsmarktsoziologie, politische Soziologie, Gewerkschaftsforschung, Kapitalismusforschung
Steffen Liebig, M.A., Arbeitsschwerpunkte: Wirtschaftssoziologie, Konfliktsoziologie, Kapitalismustheorie(n), Herrschaftssoziologie
Hanna Ketterer, MPhil, Arbeitsschwerpunkte: Grundeinkommensforschung, Freiwilligenforschung, Gesellschaftstheorie, Arbeitssoziologie.
Benjamin Seyd, Arbeitsschwerpunkte: Theorie und Soziologie der Gefühle, Wissenssoziologie, Theorien des Politischen und der Globalisierung, Populismusweiter Infos zum Projekt: www.kolleg-postwachstum.deExterner Link
-
# Technologischer Wandel, Digitalisierung und Informationsgesellschaft
"GIDA - Gute Interaktionsarbeit digital assistiert"
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Koordination: Martin Ehrlich
Laufzeit: Juni 2020-Mai 2023Förderung: BMBF
Weitere Informationen zum Projekt: www.digitale-interaktionsarbeit.deExterner LinkZeTT - Zentrum Digitale Transformation Thüringen
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Geschäftsführung: Dr. Thomas EngelLaufzeit: Januar 2020-Dezember 2022
Förderung: BMAS - Bundesministerium für Arbeit und Soziales, TMASGFF - Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Weitere Informationen: https://zett-thueringen.deExterner Link
Das vermessene Leben. Produktive und kontraproduktive Folge der Quantifizierung in der digital optimierenden Gesellschaft
Projektleitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa
Laufzeit: 01.02.2018-31.01.2021
Förderung: VW-Stiftung in der Förderlinie "Schlüsselthemen für Wissenschaft und Gesellschaft"
Weitere Informationene zum Projekt: www.ipu-berlin.deExterner Link und www.sigmund-freud-institut.deExterner Link
GAP - Gesunde Arbeit in Pionierbranchen
Projektleitung: Prof. Klaus Dörre, Thomas Engel
Förderung: BMBF
Laufzeit: 01.01.2016 - 30.04.2019
weitere Infos zum Projekt: https://gesunde-digitale-arbeit.de/projektvorstellung/Externer Link
-
# Ungleichheit, Klassen- und Eigentumsverhältnisse
Projekt Klassenanalyse Jena
Projektleitung: Prof. Dr. Klaus Dörre
Förderung: Rosa-Luxemburg-Stiftung
Weitere Informationen zum Projekt hierExterner Link
Stipendienbewerbung und Stipendienvergabe – Die Situation von Studierenden aus den neuen Bundesländern
Leitung:
Prof. Dr. Hartmut Rosa, Universität Jena, Lehrstuhl für allgemeine und theoretische Soziologie
Mitarbeiter/innen: Dr. Peter SchulzLaufzeit: 01.11.2020-31.01.2021
Förderung:
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft -
# Zeit-, Subjekt- und Weltverhältnisse im Wandel
Sprachliche Appräsentationen materialer Zeiterfahrung. Das Verhältnis dingästhetischem und sozialem Sinn in Zeitmetaphern
Leitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa, Universität Jena, Lehrstuhl für allgemeine und theoretische Soziologie
Laufzeit: 01.02.2017-31.01.2020
Förderung: DFG im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1688 "Ästhetische Eigenzeiten"
weitere Infos zum Projekt hierExterner Link
Aporien der Perfektionierung in der beschleunigten Moderne. Gegenwärtiger kultureller Wandel von Selbstentwürfen, Beziehungsgestaltungen und Körperpraktiken
Leitung: Prof. Dr. Hartmut Rosa
Mitarbeiter/innen: Dr. Diana LindnerProjektbeteiligte: Prof. Dr. Vera King, Universität Hamburg, Fachbereich für Allgemeine, Interkulturelle und International vergleichende Erziehungswissenschaft
Prof. Dr. Benigna Gerisch, International Psychoanalytic University, Klinische Psychologie und Psychoanalyse, BerlinFörderung: VW-Stiftung
Laufzeit: 01.12.2012-30.04.2018